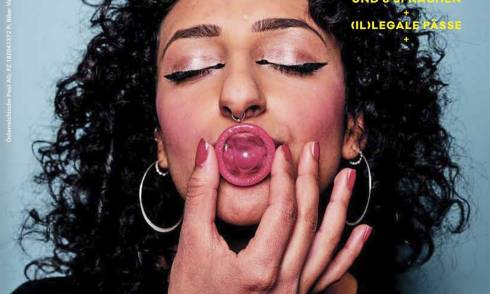„Wo ist das Brot, Habibi?“
Wenn der Versuch, sich zu verbrüdern, kläglich scheitert.
Mein erster Tag in Wien. Nach dem Bewerbungsgespräch bei biber brummt mein Magen vor Hunger. Mein Magen ist voll der aufmüpfige iranische Diktator, wenn er Hunger hat. Liebevoll nenne ich ihn Ajatollah. Ein Falafel-Halloumi-Wrap für 2 Euro mit allem und scharf. Das wär’s jetzt! Tee ist inklusive. Die Gastfreundschaft lebt. Falafelläden kenne ich aus meiner Heimatstadt Köln zu gut. Sie sind fast schon wie ein Zufluchtsort für mich: Menschen sprechen mit Akzenten. Die Musik animiert zum langsamen Hüftschwung und die langgezogene Phrasierung des letzten Tons der Sängerin ist eine Initialzündung für mein persisches Ohr. Wie zuhause. Und da – ich erblicke ein orientalisch geschmücktes Restaurant. Der heißt schon irgendwas mit Habibi, perfekt. Direkt rein, da werde ich mich wohlfühlen. Meine nahöstlichen Brüder werden mich versorgen.
Ich weiß noch nicht, welche Sprachen meine neugewonnenen Brüder sprechen, also mixe ich eine integrative Multikulti-Begrüßung, wo jeder von ihnen fündig werden sollte: „Salam Habibi, Abi, Dadash“, tönt es aus meinem lauten Sprachorgan während ich die Hand hebe und sie dann als dankbare Geste flach auf meine Brust lege. Kurz bin ich selbst überrascht über meine Lautstärke – aber egal, hier wird es ja keinen stören. Man kennt sich.
Ajatollah meldet sich zu Wort
Es gibt keine kleinen, runden Tische hier. Eigenartig. Es gibt keine Selbstbedienung. Eigenartig. Es wird sich nur leise unterhalten. Wo sind die ganzen Schwarzköpfe? Ist etwa Ramadan? Ich setze mich und der Kellner kommt. Er erklärt mir das Prinzip und als er „all you can eat“ sagt, höre ich schon nicht mehr hin. Zwar sehe ich auf der Karte einen hohen Preis, aber fair für unbegrenztes Essen. Ajatollah meldet sich zu Wort und steuert mich schnurgerade Richtung Büffet. Ich nehme mir einen Teller und gucke mich verwirrt um. „Wo ist das Brot, Habibi?“, frage ich entsetzt. Der Kellner hat die Hände hinter dem Rücken verschränkt und schaut mich ganz kritisch an. Einen ähnlich kritischen Blick werfen mir ältere, weiße Damen in der Bahn zu, wenn ich mich zu ihnen setze. Dann halten sie Taschen fest, so als würde ich sie gleich beklauen wollen.
Ich setze mich brotlos (in vielerlei Hinsicht) wieder hin und esse. Schnell. So schnell, dass Ajatollah noch einen zweiten Teller braucht. Mein Vater ruft an und ich rede mit ihm auf Farsi über meinen unangenehmen Brot-Fauxpas. Seine Witze bringen mich zum Lachen – zum lauten Lachen. Ich spüre den Blick des Kellners in meinem Rücken während ich wieder von meinem Platz aufstehe. Zurück am Büffet will ich meinen Teller gierig vollbeladen. Der Kellner unterbricht allerdings mein Vorhaben, indem er mich darauf hinweist, dass ich schon einen Teller hatte. Für den zweiten Teller müsse ich doppelt so viel zahlen. Moment? Dann werde ich aufgeklärt – erst ab dem zweiten Teller ist all you can eat. Der erste Teller muss dann separat abgerechnet werden blablabla alles urdeutsch, urösterreichisch, ur-keine-Ahnung-was. Ich blicke peinlich berührt drein und beteuere für den zweiten Teller zu zahlen. Das Restaurant wird laut Webseite von Geflüchteten geführt – und jetzt stehe ich hier und fühle mich wie eine Diebin, die sich an ihrem leckeren Essen vergreift und nicht einmal das System versteht.
Es hat sich ausgebrüdert
Irgendwas läuft gerade massiv verkehrt. Mir gleitet mein Stückchen Zuhause wie Wüstensand aus den Händen. Im Geflüchtetenrestaurant fühle ich mich auf einmal ausländischer als auf den Straßen Deutschlands. Mein Versuch mich mit den Kellnern zu solidarisieren ist total schiefgegangen. Aber kann ich mich überhaupt solidarisieren, indem ich ein paar Bruderfloskeln bringe? Fakt ist nämlich: Wir sind keine Geschwister. Vielleicht suchen diese gestandenen Männer auch keine Solidarität von irgendeiner hungrigen Deutsch-Iranerin. Das war ein egoistischer Versuch, mein eigenes Bedürfnis nach einem kleinen Zuhause in einer neuen Stadt zu stillen.
Ich fühle mich wie der Premium-Kanake aus dem Kölner Randbezirk mit schlechten Manieren. Zu laut und zu gefräßig. Muss ich mich jetzt wieder schämen? Scham kenne ich ganz gut. Vor allem aus der Bahn, wenn ältere, weiße Damen ihre Taschen festhalten. Scham kenne ich nicht aus orientalischen Restaurants. „Du kommst nicht von hier, oder?“, unterbricht der Kellner meine Negativspirale an Selbstzweifeln. Diese Frage kenne ich auch nicht aus orientalischen Restaurants. Es hat sich ausgebrüdert. Meine dunklen Haare und mein Wallah-Mashallah-Gehabe konnten mein Anderssein diesmal nicht verhüllen.
Blogkategorie: