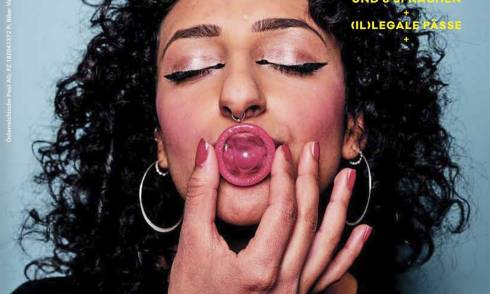Das schwarze Schaf aus dem Niemandsland
20140417_154510.jpeg

Seit elf Jahren beschäftigt mich eine Frage, die ich nicht abschütteln kann: Warum haben Menschen Angst, aus ihrem behüteten Nest herauszukommen und Unkonventionelles willkommen zu heißen? Ob die Definition von Kultur oder (im Konkreten) Muttersprache betreffend, Individualität scheint verloren zu gehen. Wichtig ist nur, dazuzugehören. Doch das Dazugehören impliziert auch etwas anderes: Das Ausgrenzen.
Als ich mit 13 nach Österreich kam, schüttelte ich den Kopf. Was soll ich hier, ein weißrussisches Mädchen? Und das in einem Gymnasium, dachte ich mir. Eine Zeit lang durfte ich negative Noten in mein Zeugnis bekommen und trotzdem in die nächste Klasse aufsteigen, wofür ich bis heute dankbar bin. Beurteilt musste ich dennoch wie alle anderen werden, damit mein Fortschritt sichtbar war.
Als ich bereits nach sechs Monaten positive Noten schrieb, war meine Deutschlehrerin stolz. Begabt sagte sie nur. Witzig, denn damals wusste ich noch nicht, was dieses Wort bedeutet. Als ich dann Jahre später in meinem Maturazeugnis in Deutsch ein „sehr gut“ erhielt, war ich selbst ein bisschen stolz.
Trotz alledem war das Erwachsenwerden in Tirol einfach – ich hatte mich dermaßen integriert, dass ich von niemandem mehr als Ausländerin bezeichnet wurde. „Was? Du bist gar nicht von hier?“ hörte ich die Leute ständig sagen. Das fühlte sich gut an, denn ich wusste, dass ich dazugehörte und je mehr Zeit verging, desto irrelevanter schien es mir, meine eigentliche Herkunft zu erwähnen. Es ist kaum zu glauben, wie schnell man seine Wurzeln verdrängen kann, wenn man sich nicht darum kümmert. Nach dem Schulabschluss wollte ich reisen. Neue Kulturen erforschen. Sprachen lernen. Spanisch war jetzt die fünfte in meinem Repertoire. Und als ich dann nach meinem halbjährigen Praktikum in Costa Rica wieder nach Tirol zurückgekehrt war, fehlte mir etwas. Ich wusste, ich wollte nach Wien. Wien kam mir wie eine Metropole vor: multikulturell, offen, reich an Möglichkeiten - das waren die Schlagwörter, die ich mit der Hauptstadt assoziierte. Die Stadt verkörperte alles, was sich ein junger Mensch nur wünschen könnte. Ich fühlte mich wohl, doch plötzlich waren sie da, die Selbstzweifel. Ganz unerwartet wurde ich mit der unbegründeten Notwendigkeit konfrontiert, das Wort Muttersprache als einen rigiden, adynamischen Begriff verstehen zu müssen.
Die Muttersprache, die keine Muttersprache ist
Ich erzählte einer Bekannten hier in Wien, dass ich das Schreiben unbedingt zu meinem Beruf machen möchte. Daraufhin fragte sie mich, wie ich mir dieses Vorhaben in einer Fremdsprache im deutschsprachigen Raum vorstelle. Als ich ihr zu erklären versuchte, dass ich unter anderem auf Deutsch schreiben möchte, reagierte sie verdutzt: „Aber Deutsch ist doch nicht deine Muttersprache!“
Was diese Aussage für einen Sinn haben soll, war und bleibt mir ein Rätsel. Was IST denn tatsächlich Muttersprache? Aber Julya Rabinowich hat es doch geschafft. Und Vladimir Vertlib auch, dachte ich mir und schwieg. Außerdem fragte ich mich, ob man unabhängig davon, wie gut man der deutschen Sprache mächtig ist, schon allein aufgrund von seiner ausländischen Herkunft diskriminiert wird. Lange wusste ich nicht, dass Menschen Angst verspüren, aus ihrem behüteten Nest herauszukommen und das zu tun, was ihnen wichtig ist, auch wenn es ihrem Verständnis von „normal“ nicht entspricht. Derartige Annahmen dienen zur Verstärkung der Idee, dass wir keineswegs die Kontrolle über unser Leben bewahren können. Es scheint einen vorbestimmten Weg zu geben, dem wir wie Marionetten schweigsam folgen müssen. Unkonventionelle Träume verlieren an Wert, während die Sicherheit der Zukunft im Vordergrund steht.
Die Westlerin
Die meisten aus meiner Familie leben in Russland. Sprachlich gesehen besteht zwischen Weißrussland und Russland eigentlich kein Unterschied, da in beiden Ländern Russisch die offizielle Sprache ist. Kulturell gesehen allerdings schon. Was die beiden Länder verbindet, ist deren Auffassung von Fremdheit. Ich weiß es ja am besten, weil ich mittlerweile auch schon als „die Westlerin“ bezeichnet werde. Egal, ob die Entscheidungen die Mode oder die Lebenseinstellung betreffen, man zieht als „Fremde/r“ immer den Kürzeren. Oder zumindest sagt mir mein Gefühl, dass es so ist. Wenn ich in Russland bin, verspüre ich ein Gefühl von Nostalgie, das mich sehr melancholisch werden lässt. Umso mehr verletzt es mich, wenn meine Familie mit Skepsis fragt, ob ich denn meine Wurzeln ganz vergesse, wenn ich Deutsch spreche.
Vergessen tu' ich nichts, denk' ich mir. Verjagt fühl' ich mich schon ein bisschen.
Vielseitigkeit statt Identitätschaos
Wenn man ständig von allen Seiten als fremd dargestellt wird, frage ich mich Folgendes: Wohin gehört jemand, der zwei Kulturen angehört? Welche Kultur ist denn die „echte“? Ist es die, in die man als erstes hineingeboren wurde? Oder können mehrere Kulturen gleichzeitig die „richtigen“ sein? Als Studentin am Institut für Translationswissenschaften habe ich in meinem Studium gelernt, dass der Enkulturationsprozess ein Leben lang andauert, denn wir passen uns ständig an neue Umgebungen an. Na, wenn das so ist, frage ich mich warum die Menschen immer den Drang verspüren, einander kategorisieren zu müssen? Was ist aus dem Privileg geworden, zwei oder mehr Sprachen fließend zu sprechen? Oder zwei Kulturen zu verstehen und fühlen zu können? Beiden angehören zu dürfen?
Ich verspüre den Drang, mich einer neuen Kultur angehörig zu fühlen, einer, die als keine bestimmte klassifiziert wird. Einer, die unabhängig von Nationalgrenzen besteht und fruchtet. Einer, die nicht (be-)wertet. Einer, die nicht bezweifelt, dass auch ein/e Ausländer/in auf Deutsch seine/ihre Werke veröffentlichen kann. Einer, die es willkommen heißt, dass man anders ist. Dass man vielseitig ist. So sehen mich meine Freunde, die es gut finden, dass ich anders bin. Vielseitig. Auch wenn sie mich immer noch dafür auslachen (und es wahrscheinlich immer tun werden), dass ich zu allem Brot dazu esse.
Jedem das Seine, würd' ich mal sagen.
Blogkategorie: