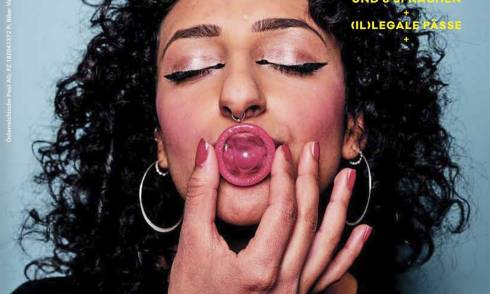Manchmal wäre ich gerne leichter
Ich fühle gerade alle Gefühle, denn es ist schwer. Verdammt schwer, über etwas zu schreiben, das man irgendwie immer zu verstecken versucht. Tausend Gedanken schwirren mir im Kopf herum, warum ich es nicht machen sollte. Warum es eine schlechte Idee sein könnte. Dass es nichts Erwähnenswertes ist, weil es eh so viele Menschen haben. Aber ich glaube genau das ist der beste Grund, warum ich darüber sprechen muss. Damit sich irgendjemand da draußen nicht mehr so alleine fühlt. Ich habe eine Angststörung und Panikattacken. Jetzt ist’s raus. Schwarz auf weiß.
Keine Ahnung, wie sich das jetzt anfühlen soll. Man macht sich verwundbar und gibt sein Innerstes Preis, beides Sachen, die ich nicht so gern mache. Die wahrscheinlich niemand gerne macht. Aber genau darum ist es so wichtig. Denn ich glaube, alles, was einem irgendwie schwerfällt auszusprechen, ist eben wichtig. Wenn die Lippen beben, der Hals sich zuschnürt und man die Schweißtropfen auf der Stirn spürt – genau dann ist es umso wichtiger, es laut zu sagen.
Berg, den ich nicht erklimmen kann
Gerade in Zeiten wie jetzt, in denen sich viele unsicher fühlen, sollte man Ängste offen ansprechen, weil sie jetzt noch viel mehr Leute betreffen als sonst. Der geregelte Alltag fällt weg und das ganze große Leben muss sich nun plötzlich innerhalb von vier engen Wänden abspielen. Das war auch für mich zunächst eine Herausforderung. Treffen mit Freunden, Besuche bei der Familie und sowieso alles was Spaß macht, fällt weg. Man beschäftigt sich irgendwie den ganzen Tag, aber erlebt nichts. Das hat mich müde gemacht und meine Ängste haben sich durch Corona anfangs verstärkt. Dann habe ich mich bewusst dazu entschieden, aktuelle Nachrichten und Zahlen nur noch einmal täglich zu verfolgen und Hobbies, die ich irgendwo in einer verstaubten Kiste eingegraben habe, wieder auszubuddeln. Das hat mir geholfen, irgendwie den gesunden, nötigen Abstand zu bewahren und nicht völlig in der Unsicherheit unterzugehen.
Ab und zu würde ich mich gerne leichter fühlen. Würde gerne nicht einen Gedanken über den anderen stapeln, um dann festzustellen, dass ich vor einem Berg stehe, den ich nicht erklimmen kann. Nicht hundertmal überlegen, ob ich alleine joggen gehen, ein Konzert besuchen oder in den Urlaub fliegen kann. Nicht darüber nachdenken, ob ich das überhaupt schaffe und was passieren würde, wenn ich genau dann eine Panikattacke hätte. Manchmal wäre ich wirklich gerne leichter.
Seit knapp einem Jahr mache ich nun Therapie. Auch in den letzten Wochen konnte ich sie fortführen und es hat mir in der Zeit der sozialen Isolation extrem geholfen, mich mit jemandem auszutauschen. Ich hätte nie geglaubt, wie sehr einem reden helfen kann. Reden mit einem unabhängigen Menschen, der nicht versucht, dir seine Geschichte zu erzählen, sondern dir einfach nur zuhört. Anfangs fiel mir das schwer, so viel über mich selbst zu sprechen. Ich habe immer gedacht, das sei nicht wichtig. Anderen geht es ja schließlich schlechter. Aber Fakt ist, es gibt immer einen anderen, dem es schlechter geht als einem selbst. Das eine spricht dem anderen aber nicht seine Daseinsberechtigung ab. Darüber musste ich mir erst mal bewusst werden und das ist immer noch ein stetiger Prozess. Ein Hamsterrad, in dem sich so viele befinden, da man von allen Seiten zu hören bekommt, dass man doch einfach mal nicht so viel nachdenken sollte. Aber so einfach ist das nicht. Den Kopf kann man nicht mal eben ausschalten wie die Gasflamme beim Kochen. Er brodelt stets weiter.
Es darf beschissen sein
Ich habe gelernt, dass man nicht immer alles positiv sehen muss. Dass es einem schlecht gehen darf und man nicht immer daran denken muss, dass es wieder besser wird. Es darf einfach nur beschissen sein, wenn man mit zittrigen Knien in der Schlange einer Supermarktkassa steht und einem das Herz bis zum Hals schlägt, obwohl man sich nicht erklären kann, warum. Es darf einen auch richtig traurig machen, wenn man sich nicht überwinden kann, ein Konzert mit Freunden zu besuchen, weil man zu große Angst hat, dass man dort zusammenklappen könnte. Und es darf auch richtig, richtig wehtun, wenn man kurz vor dem Berggipfel umdrehen muss, weil man sich nicht traut, über den schmalen Pfad zum Gipfelkreuz weiterzugehen. Und es wieder nicht geschafft zu haben. Das darf wirklich wehtun.
Das ist es, was mir am meisten geholfen hat. Gefühle zuzulassen und ihnen nicht ihre Wichtigkeit abzusprechen. Sie einfach sein zu lassen und anzunehmen. Ich bin immer noch nicht wirklich gut darin. Die Überwindung, diesen Text zu schreiben und die zahlreichen Gründe, die in mir wie Spams im E-Mail-Eingang aufgepoppt sind, warum ich es nicht tun sollte, gehören auch immer noch dazu. Aber genau das macht mich auch irgendwie stolz, weil ich wieder etwas geschafft habe, vor dem ich mich gefürchtet habe. Allen eigens auferlegten Zweifeln und Ängsten zum Trotz, steht der Text jetzt nun trotzdem da. Schwarz auf weiß. Zeile für Zeile.
Um die Angst als Antrieb im Rücken haben zu können, muss man sie sich erst mal vor Augen führen. Vielleicht ist es auch genau das. Zu wissen, dass es auch mal schwer sein darf. Vielleicht wär ich gar nicht gerne leichter, vielleicht wäre ich gerne einfach mehr ich selbst.
Blogkategorie: